NEU: Fhelerkultur
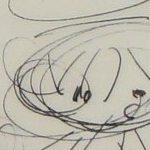 Die Welt ist voller Fragen! Wer waren eigentlich Käpt’n Nuss und Blendi? Wie lautet der dämlichste Filmtitel aller Zeiten? Was versteht man unter »Silly Season«? Warum konnte die Menschheit fortbestehen, obwohl Adam und Eva nur zwei Söhne hatten? Und wie kommt es, dass Modeschöpfer Karl Lagerfeld ausgerechnet durch Jogginghosen unsterblich wurde?
Die Welt ist voller Fragen! Wer waren eigentlich Käpt’n Nuss und Blendi? Wie lautet der dämlichste Filmtitel aller Zeiten? Was versteht man unter »Silly Season«? Warum konnte die Menschheit fortbestehen, obwohl Adam und Eva nur zwei Söhne hatten? Und wie kommt es, dass Modeschöpfer Karl Lagerfeld ausgerechnet durch Jogginghosen unsterblich wurde?
In »Fhelerkultur – neue nutzlose Gedanken zu Dingen, die sowieso nicht zu ändern sint« werden all diese Fragen wahrheitsgemäß beantwortet. Wie beim Vorgängerband »Ist Götterspeise Blasphemie?« handelt es sich hierbei um neue und ältere Texte, die für diese Ausgabe vollständig überarbeitet wurden. Fun Fact: Ursprünglich sollte das Buch »Wie man Katzen zum Platzen bringt« heißen. Doch nach einigen internen Diskussionen siegte am Ende die Vernunft.
»Fhelerkultur«, der zweite Band der edition wortmax, ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.
Bestsellerpotential

»Wer anfängt, seine Memoiren zu schreiben, gibt damit zu, aufgegeben zu haben«, meint US-Comedian Bill Maher. Es sei so ähnlich wie Senioren, die plötzlich anfangen Golf zu spielen.
Andererseits behauptete Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki einmal, dass jeder Autor zumindest eine gute Geschichte in sich habe – nämlich die eigene.
Ganz Faule veröffentlichen daher einfach ihre Tagebücher oder noch besser: sie schreiben sie um. Man will ja nicht als Depp dastehen. Als Cartoonist hat man hier natürlich den Vorteil, ein aufregendes Leben zu führen. In dem Beruf jagt eine spannende Situation förmlich die nächste. Wie neulich, als mir am Computer der Kaffeebecher umgekippt ist. Die Tastatur war natürlich sofort futsch. Literarisches Gold, das darauf wartet, zutage gebracht zu werden, denn das Bestsellerpotential von Erinnerungsbüchern ist enorm.
Hier wäre eine typische Woche in meinem Leben.
Montag:
Es wird stressig. Bis Freitag muss ich zehn Cartoons für einen neuen Sampler schaffen. Eigentlich kein Problem, wenn nicht draußen so schönes Wetter wäre. Ich hoffe, ich kann der Versuchung widerstehen, ins Schwimmbad zu fahren …
Fast unmerklich habe ich hier Spannung erzeugt. Ein altes Thema: Arbeitsmoral gegen die Verlockungen des Klimawandels. Wie wird dieses Drama enden, fragt sich der geneigte Leser.
Dienstag:
Mein Radiergummi ist weg. Auch die Durchsuchung meines Arbeitszimmers bleibt erfolglos. Also schnell aufs Fahrrad gesprungen und zum Zeichenbedarfsgeschäft meines Vertrauens geradelt. Dadurch jedoch den halben Vormittag verloren. Schließlich bis Mitternacht durchgearbeitet, um die verlorene Zeit wettzumachen. Trotzdem leider keine gute Idee gehabt.
Die Lage spitzt sich zu. Ist die Deadline noch zu schaffen?
Mittwoch:
Mein alter Freund Ulli kommt unangemeldet auf einen Kaffee vorbei. Mist! Obwohl ich eigentlich keine Zeit habe, werden aus einer halben Stunde ganz schnell zwei. Wieder ein halber Vormittag futsch. Danach bin ich so wütend, dass ich abermals keine Einfälle habe. Genauso gut kann ich ins Schwimmbad fahren.
Die Woche ist halb um und noch immer keine brauchbare Cartoonidee in Sicht. Nur noch zwei Tage bis zum Wochenende.
Donnerstag:
Bei der Recherche im Internet bei YouTube hängengeblieben. Wie immer entdecke ich viele lustige Katzenvideos, die mir unbekannt waren. Wer lädt dieses Teufelszeug hoch? Es sollte verboten werden! Wie soll man da zum Arbeiten kommen? Es ist zum Verzweifeln.
Ein weiterer schonungsloser Blick auf die harte Existenz eines Künstlers. Die Spannung ist auf dem Siedepunkt.
Freitag:
Auf dem Dachboden die alten Witzbücher meines Großvaters durchsucht. Damit lässt sich bestimmt etwas Brauchbares zusammenbasteln. Bin erleichtert, in letzter Minute auf diese Idee gekommen zu sein. Zu Belohnung spendiere ich mir im Café einen Eisbecher. Die Cartoons kann ich am Wochenende zeichnen. Oder noch besser, alte Zeichnungen mit neuen Bildunterschriften versehen. Merkt ja sowieso keiner.
Man sieht: Mit etwas Know-how wird jede Alltagsbeschreibung zum packenden Thriller. Kein Wunder, dass Erinnerungsbücher zu den Verkaufshits der Branche zählen. Allerdings sollte man vermeiden, sein Werk mit einer solchen Situation zu beginnen. Eine Steigerung ist fast unmöglich.
Wandern!

Im Miethaus gegenüber wohnt eine Frau, die den ganzen Tag lang aus dem Fenster schaut. Woher ich das weiß? Ich beobachte sie dabei.
Zumindest habe ich eine gute Ausrede: Als »Kreativer« ist es praktisch meine Pflicht, dem Volk aufs
Maul zu schauen. Zumindest meine ich im Aufnahmeantrag der Künstlersozialkasse etwas Ähnliches gelesen zu haben. Alle anderen sind natürlich Gaffer, Spanner, Schaulustige und Voyeure, die mit äußerster Vorsicht betrachtet werden müssen. Oder am besten aus sicherer Distanz, um nicht am Ende selbst
als Gaffer dazustehen.
Gaffer gab es schon immer. In der DDR nannte man sie »Stasi«. Allen Gaffern, die in der BRD lebten, reichte dagegen ein unverstellter Blick auf falsch parkende Autos, damit es wenigstens etwas zum Denunzieren gab. Statt im RTL-Dschungelcamp auf seine Kosten zu kommen, ging der gemeine Gaffer früher in sogenannte »Peepshows«.
Das Gaffen liegt den Menschen im Blut. In der Vergangenheit waren es Sex, Verkehrsunfälle und Skandale, von denen wir nicht genug bekommen konnten, doch das Internet und die dadurch resultierende Übersättigung veränderten alles.
Heutzutage zieht es uns zu Ostern, wenn es langsam etwas wärmer wird, in die Wälder, um unsere Social-Media-Kanäle zu bespielen. Im Winter genügen Fotos vom Weihnachtsmarkt, vom Schnee im Garten und dem Feuerwerk am Jahreswechsel. Im Frühjahr allerdings müssen es Bäume und Berge sein.
Plötzlich bevölkert eine Armada neugieriger Urbanistas die Natur, um Ausschau nach Eichhörnchen, Erdhörnchen oder Einhörnchen zu halten.
Wandern ist der neue Voyeurismus für die ganze Familie; die Natur eine einzige Peepshow für neuzeitlich-nachhaltige Öko-Freaks. Jedoch mit dem großen Vorteil, dass nirgendwo Münzen eingeworfen werden müssen, um zu sehen, wie die Akteure sich paaren.
Zudem stellt man unter Beweis, dass die Beine vom winterlichen Binge-Watching noch nicht ganz abgestorben sind.
Wer ein echter Naturliebhaber ist, will das auch zeigen – und wenn er dafür stundenlang auf der Autobahn im Stau stehen muss. Für die Umwelt ist schließlich kein Opfer zu groß. Mit einer schicken Jack Wolfskin-Jacke und Nordic Walking Stöcken ausgerüstet kann es losgehen.
Natürlich ist für kernige Wandergesellen ein Selfiestick unverzichtbar, um das Großereignis Social-Media-tauglich zu inszenieren.
Beim Holocaust waren die Verursacher später leicht auszu- machen. Beim neuen Volkssport Wandern gestaltet sich die Suche schon etwas schwieriger. Wer ist schuld daran, dass alltagsmüde Städter, mit ihren von Großstadtlärm und Autoabgasen geschundenen Seelen, durch Fichten-Monokulturen irren, um in den Armen von Mütterchen Natur Erlösung zu suchen?
Ein Vorreiter dieser Massenbewegung ist bestimmt Manuel Andrack, der seit vielen Jahren als »Wander-Papst« seinen wanderbestiefelten Jüngern vom Wanderglück predigt. Andracks Spannbreite reicht dabei vom Alten Testament (»Du musst wandern«), zur Bergpredigt (»Wandern. Das deutsche Mittelgebirge für Amateure und Profis«), bis zur Reformation (»Mit Kindern wandern« und »Das neue Wandern. Unterwegs auf der Suche nach dem Glück«).
Vielleicht ist es tatsächlich das Glück, das man in den Wäl-dern zu finden erhofft. Vielleicht versteckt es sich ja irgendwo am Harzer Brocken.
Die Suche danach muss natürlich minutiös dokumentiert werden. Statt wie früher nur den richtigen Weg zu finden, müssen heutige Wandersleute unentwegt aussagekräftige Bilder und Filmchen posten. Was die meisten Wanderführer bislang
verschweigen: Es ist anstrengend, einen guten Schwenk mit dem Selfiestick hinzulegen, ohne zu wackeln. Ständig kommen andere (filmende) Wanderer ins Bild gelaufen, deren Persönlichkeitsrechte gewahrt werden sollten. So artet die Erholung ganz leicht in Stress aus.
Hinterher ist man allerdings froh, sich ein paar Kilometer lang bewegt zu haben. Nur leider ist das Essen in der nächsten Gaststätte so fetthaltig, dass man nach der Wandertour eher zu- als abgenommen hat. Trotz alledem: Wandern ist toll. Wenn man in den Wäldern nur ein paar zusätzliche Parkplätze bauen würde, damit man nicht so verdammt weite Wege hat! Daher ist es letztendlich besser, die Natur vom Wohnzimmerfenster aus zu betrachten. Meine Nachbarin von gegenüber und ich finden das auch.
Grundschul-Trekkie
 Es war ein denkwürdiger Tag, als zum ersten Mal im deutschen Fernsehen »Star Trek« lief. Zuvor gab es an jedem Samstag »S.O.S. – Charterboot«, eine Serie über einen amerikanischen Skipper, der vor der Küste Australiens in allerlei Abenteuer schipperte und bei mir und meiner Schwester hoch im Kurs stand.
Es war ein denkwürdiger Tag, als zum ersten Mal im deutschen Fernsehen »Star Trek« lief. Zuvor gab es an jedem Samstag »S.O.S. – Charterboot«, eine Serie über einen amerikanischen Skipper, der vor der Küste Australiens in allerlei Abenteuer schipperte und bei mir und meiner Schwester hoch im Kurs stand.
Plötzlich jedoch mussten Moss Andrews und sein Charterboot den Sendeplatz für ein ominöses Raumschiff namens »Enterprise« räumen. Das gefiel mir, der schon damals gegen jede Art von Veränderung war, zunächst gar nicht.
Besonders der Samstag war ein Tag der Rituale. Nur an diesem Abend gönnte sich mein Vater beim Abendbrot eine Flasche Bier. Bei Fanta und Mettbroten wurde dann der Fernseher angestellt, bevor ich später in die Badewanne geschickt wurde.
1972 galt Science Fiction in Deutschland noch als Schundliteratur. »Raumschiff Enterprise« war daher nicht nur im Kreise meiner Familie höchst umstritten. Von den meisten Erwachsenen wurde die Serie ignoriert. In vielen Programmzeitschriften bildete man die Enterprise daher anfangs stets auf den Kopf gestellt ab.
Meine Schwester allerdings war sofort ein Fan. Jeder Artikel, der damals über die Serie erschien, wurde ausgeschnitten und archiviert. Nach einigen Folgen hatte ich die Crew der Enterprise ebenfalls ins Herz geschlossen. Als wir in der Schule eines Tages die Aufgabe bekamen, mit Wachsmalkreide ein Selbstporträt zu zeichnen, zeichnete ich nicht mich, sondern Mr. Spock und in einer freien Ecke die Enterprise.
Die Zeichnung war bei meinen Mitschülern ein Hit. Praktisch über Nacht wurde ich als »Zeichner« abgestempelt und musste in den Folgemonaten ständig mein dürftiges Talent unter Beweis stellen.
Um meinem unverdienten Ruf gerecht zu werden, nahm das Zeichnen einen stetig größeren Raum in meinem Leben ein. Besonders oft versuchte ich mich dabei an der Enterprise selbst, die für einen Zweitklässler eine zeichnerische Großtat darstellte. Nur wenige Jahre später entschied ich mich, die Zeichnerei zum Beruf zu machen.
Damals machte man sich im Satireblatt MAD über den ständig wachsenden Erfolg der zu diesem Zeitpunkt längst eingestellten Serie lustig. Meine Generation würde vom Kindes- bis zum Greisenalter vor der Glotze sitzen und »Star Trek« schauen, spekulierte man gehässig.
Niemand konnte ahnen, dass in den nächsten Jahrzehnten etliche Kinofilme, Spin-Offs und Neuauflagen folgen sollten. Aus einer MAD-Satire wurde so schließlich Realität.
Mittlerweile sind fast alle Darsteller von »Raumschiff Enterprise« von uns gegangen und selbst die Stars von »Star Trek: The Next Generation« schrammen hart an der »Final Frontier«. »Star Trek« hat heute sogar MAD überlebt und wird wohl auch mich überleben.
Als neulich die letzte Staffel von »Star Trek: Picard« im Free-TV anlief, wurde mir bewusst, dass dies das Ende einer Ära ist. Vor allem wurde mir bewusst, wie sehr eine Fernsehserie mein Leben geprägt hat. Immer wieder frage ich mich: Was wäre wohl aus mir geworden, wenn meine Eltern damals lieber ARD gesehen hätten, wo am gleichen Sendeplatz die »Sportschau« lief?
Mitbewohner
 Eine Freundin von mir hat seit neuestem einen Untermieter. Wenn ich nun zur Kaffeestunde mit ihr in ihrer Küche sitze, kann es durchaus passieren, dass ein bärtiger Mann im Bademantel herein schlurft. »Tach«, sagt er dann nur knapp, schnappt sich etwas aus dem Kühlschrank und verschwindet stehenden Fußes in sein Zimmer. Etwas befremdlich finde ich das schon. Meine Freundin hat jedoch WG-Erfahrung und meint, so etwas sei ganz normal.
Eine Freundin von mir hat seit neuestem einen Untermieter. Wenn ich nun zur Kaffeestunde mit ihr in ihrer Küche sitze, kann es durchaus passieren, dass ein bärtiger Mann im Bademantel herein schlurft. »Tach«, sagt er dann nur knapp, schnappt sich etwas aus dem Kühlschrank und verschwindet stehenden Fußes in sein Zimmer. Etwas befremdlich finde ich das schon. Meine Freundin hat jedoch WG-Erfahrung und meint, so etwas sei ganz normal.
Früher musste sie stundenlang vor dem WC warten, wenn sich ihre Mitbewohnerin mit einem Lover in der Badewanne vergnügte. Natürlich hätte sie sich auch zu ihnen ins Bad begeben dürfen, so weltoffen war man damals schon, doch irgendwie mochte sie nicht vor den Beiden die Hosen runterlassen.
Der große Knall kam, als sich ihre Mitbewohnerin ständig Sachen von ihr auslieh, ohne jedoch vorher zu fragen. Irgendwann entdeckte sie einen großen Brandfleck auf ihrer Lieblingsjacke. Zur Rede gestellt, zeigte die Mitbewohnerin keinerlei Schuldbewusstsein. »Ist doch nur eine Jacke«, kommentierte sie lapidar. Danach durfte sie flugs ihre Koffer packen, denn der Mietvertrag lief zum Glück auf den Namen meiner Freundin.
Ich selbst hatte nie in einer WG gehaust. Als ich von zuhause wegzog, war ich froh, endlich mein eigenes Reich zu haben. Am Anfang war es jedoch sehr schwer, plötzlich allein zu leben. Dazu in einer anderen Stadt. Die ersten Tage waren furchtbar. Ich sehnte mich nach meinem ach so ruhigen Zimmer bei den Eltern, denn plötzlich wohnte ich mitten in einer großen Stadt, in der es lauter zuging, als in meinem verschlafenen Heimatort. Vor allem hatte ich nun Nachbarn, die alles, was ich tat, neugierig observierten.
Links von mir wohnte eine pensionierte Lehrerin, die einmal mit einem weißen Handschuh übers Treppengeländer strich, um zu demonstrieren, wie schlampig ich das Treppenhaus geschrubbt hatte. Auf der anderen Seite lebte eine alte Dame, bei der es immer ein wenig nach Urin roch, wenn sie die Tür öffnete. Über mir wohnte eine schwerhörige Rentnerin, die rund um die Uhr Volksmusik hörte – und zwar so laut, dass ich hätte mitschunkeln können. Wenige Wochen, nachdem ich einzog, verstarb sie auf dem Klo sitzend, wie Elvis Presley.
Der einzige Lichtblick im Haus war eine sehr attraktive Erzieherin im Erdgeschoss. Sie hatte die monumentalste Kehrseite, die ich je bei einer Frau gesehen hatte. Mit all ihren Macken und Marotten sorgten sie dafür, dass ich mich nicht zu einsam fühlte, in meiner neuen Behausung.
WGs erlebte ich nur als Gast. Ständig gab es dort große Diskussionen. Egal, ob es der Kühlschrank war, der nicht richtig gesäubert wurde, oder die defekte Glühbirne im Flur, die niemand auswechseln mochte. Ständig wurde genörgelt und gemeckert. Der größte Streitpunkt war immer das Bad, in dem ständig jemand vor, auf oder neben die Klobrille gepinkelt hatte. Auch verschimmelte Duschvorhänge schienen in einer WG eine große Rolle zu spielen.
Im Grunde war eine Wohngemeinschaft so etwas wie ein Ehe-Bootcamp, in dem man darauf geschult wurde, Kompromisse zu schließen und sich rund um die Uhr auseinanderzusetzen. Besonders für Frauen hatte so etwas durchaus Vorteile: Männer mit WG-Erfahrung schrauben jede Senftube zu und pinkeln garantiert im Sitzen. Allein deswegen, weil sie einfach keine Lust mehr haben, sich zu rechtfertigen.
Ein wenig bedaure ich schon, nie in einer WG gelebt zu haben, denn dort werden Freundschaften fürs Leben geschlossen. Fast wie bei der Bundeswehr. Da ich jedoch etliche Freunde hatte, die in Wohngemeinschaften lebten, bekam ich oft sehr viel mehr mit, als mir lieb war.
Besonders schlimm wird es, wenn sich ein männlicher Bewohner in eine Mitbewohnerin verliebt. Ein guter Freund von mir jammerte oft, dass eine attraktive Frau in seiner WG jeden Abend einen anderen Kerl mit nach Hause schleppte und er nebenan mitbekam, was sie alles mit ihm anstellte. Während die Lustschreie seiner Angebeteten durch die dünne Zimmerwand hallten, weinte er sich einsam in den Schlaf.
Wenn WG-Unerfahrene gezwungen sind, für kurze Zeit als Untermieter zu leben, kann dies ebenfalls zur Katastrophe führen. Vor einigen Jahren vermittelte ich einen Bekannten an eine alte Freundin. Er suchte ein Zimmer, sie brauchte Geld – eine gute Kombination, dachte ich. Anfangs sah es fast so aus, als ob zwischen den Beiden mehr entstehen würde, als nur ein Wohnverhältnis – bis er mitbekam, dass sie nachts in die Dusche pinkelte, statt ins Klo, das sich auf halber Treppe befand. Man sollte meinen, dass ein Mann, der ein Jahr als Entwicklungshelfer im tiefsten südamerikanischen Dschungel gelebt hatte, Schlimmeres gewohnt war. War er aber nicht. Als er bei ihr auszog, schüttete er zum Abschied einen Beutel Katzenstreu in die Duschwanne.
Beide sprachen nie wieder ein Wort mit mir.
Wortmax goes print
 Fast immer, wenn man auf der Buchmesse Autoren trifft, ist von einem Projekt die Rede, »für das sich sowieso kein Verlag interessiert«. Im Grunde ist das ein trauriger Moment. Denn viele dieser Projekte klingen hochinteressant, nur werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit nie umgesetzt. Durch stetig sinkende Verkaufszahlen verunsichert, setzen Verlage immer mehr auf Altbewährtes. Von der Experimentierfreude vergangener Jahrzehnte ist immer weniger zu spüren.
Fast immer, wenn man auf der Buchmesse Autoren trifft, ist von einem Projekt die Rede, »für das sich sowieso kein Verlag interessiert«. Im Grunde ist das ein trauriger Moment. Denn viele dieser Projekte klingen hochinteressant, nur werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit nie umgesetzt. Durch stetig sinkende Verkaufszahlen verunsichert, setzen Verlage immer mehr auf Altbewährtes. Von der Experimentierfreude vergangener Jahrzehnte ist immer weniger zu spüren.
Dabei war es nie so einfach Bücher zu publizieren. Die nötige Software haben viele auf dem Rechner. Dazu gibt es unzählige Druckereien, die potentielle Autoren von Kleinstauflagen als Zielgruppe anvisieren. Die Hersteller von eBooks haben es sogar noch einfacher. Die sozialen Medien ersetzen dabei Vertreter und Presseabteilung. Das verlegerische Risiko liegt hier bei Null. Kein Wunder, dass »crossmediales Publizieren« in aller Munde ist.
Branchenkenner werden spätestens jetzt müde lächeln, denn erfahrene Schriftsteller scheuen dieses Risiko. Sie wissen, dass Herstellung, Werbung und Vertrieb eines Buches wesentlich einfacher ist, wenn man einen Verlag im Rücken hat, zumal wenn dieser mit gutem Ruf der Veröffentlichung ein Gütesiegel verleiht. Und doch gibt es Autoren, die diesen Schritt bereits gewagt haben; beispielsweise ihren Backkatalog im Selbstverlag herausbringen und auf ihrer Website bewerben. Schließlich ist jedes verlagsvergriffene Buch für den Schriftsteller totes Kapital.
Nach zwölf Jahren wortmax haben wir uns entschlossen selbst die Arena des crossmedialen Publizierens zu betreten. Viele in unserem Team haben auf dem Gebiet der Buchherstellung langjährige Erfahrung und bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Warum nicht dieses Wissen nutzen, um eigene Lieblingsprojekte umzusetzen, dachten wir uns.
Das erste Buch der edition wortmax ist ab sofort erhältlich. Es trägt den schönen Titel »Ist Götterspeise Blasphemie?« und enthält Texte von Karsten Weyershausen. Einige dieser Texte wurden bereits auf unserer Website veröffentlicht. Für die Buchversion wurden sie allerdings überarbeitet und ergänzt.
Wir sind gespannt, wie dieser Versuchsballon angenommen wird.
Wir möchten in unserer neuen edition wortmax Bücher herausbringen, die uns besonders am Herzen liegen und mit der Geschichte unseres Blogs verbunden sind. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt.
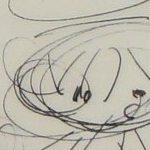 Die Welt ist voller Fragen! Wer waren eigentlich Käpt’n Nuss und Blendi? Wie lautet der dämlichste Filmtitel aller Zeiten? Was versteht man unter »Silly Season«? Warum konnte die Menschheit fortbestehen, obwohl Adam und Eva nur zwei Söhne hatten? Und wie kommt es, dass Modeschöpfer Karl Lagerfeld ausgerechnet durch Jogginghosen unsterblich wurde?
Die Welt ist voller Fragen! Wer waren eigentlich Käpt’n Nuss und Blendi? Wie lautet der dämlichste Filmtitel aller Zeiten? Was versteht man unter »Silly Season«? Warum konnte die Menschheit fortbestehen, obwohl Adam und Eva nur zwei Söhne hatten? Und wie kommt es, dass Modeschöpfer Karl Lagerfeld ausgerechnet durch Jogginghosen unsterblich wurde? 






